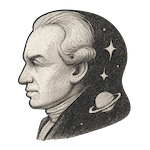Warum alles was du über dein Ich zu wissen glaubst FALSCH ist (Das Leib-Seele-Problem)
Wenn die Theorie des Epiphänomenalismus stimmt, kannst du gar nichts dafür den Clickbait-Titel geklickt zu haben. Dein Gehirn hat die Entscheidung für dich getroffen, Millisekunden bevor dein Ich davon überhaupt etwas mitbekommen hat (dazu später mehr). Die Frage nach dem Ich, der Seele, dem Bewusstsein ist seit jeher eine zentrale Grundfrage der Philosophie des Geistes. Es heißt Leib-Seele-Problem und behandelt die Frage nach dem Wesen des Geistes und dessen Zusammenwirken mit dem Körper. Ich werde das Problem anhand eines bekannten Trilemmas beleuchten und die interessantesten Positionen der Philosophiegeschichte kompakt darstellen.
Peter Bieri (1944–2023) hat mit dem nach ihm benannten Trilemma ein anschauliches Beispiel geschaffen, um das Leib-Seele-Problem zu verstehen.1 Es besteht aus drei Thesen. Das Trilemma entsteht, weil immer nur zwei gleichzeitig wahr sein können; sobald alle drei wahr sind, ergibt sich ein logischer Widerspruch. Es lautet:
- Mentale Phänomene sind nicht physische Phänomene.
- Mentale Phänomene sind im Bereich physischer Phänomene kausal wirksam.
- Der Bereich physischer Phänomene ist kausal geschlossen.
Die erste These besagt, dass mentale Phänomene, wie unser Bewusstsein, nicht physisch sind. Gemeint damit ist, dass unser Bewusstsein nicht wie das Betriebssystem eines Computers ist, welches Hardware benötigt, um ausgeführt zu werden, sondern eine eigenständige Entität ist, losgelöst von allem Leiblichen. Die zweite These besagt, dass diese mentalen Phänomene Auswirkungen auf die physische Welt haben. Ist uns etwas peinlich, erröten wir. Entscheiden wir uns dazu einen Baum zu fällen, wird der Baum gefällt. Die dritte These besagt, dass der Raum des Physischen kausal geschlossen ist, also dass alles Physische auch eine physische Ursache hat. Wenn die Kettensäge gestartet wird, ist die physische Ursache der Zug des Baumfällers, sobald der Motor läuft wird Benzin verbrannt, welches die Ursache dafür ist dass der Motor weiterhin läuft und uns am Ende den Baum fällen lässt.
Für sich allein genommen, scheinen alle drei Thesen schlüssig und sinnvoll zu sein. Dass sie aber zusammen nicht gleichzeitig wahr sein können, lässt sich schon am Beispiel der Entscheidung den Baum zu fällen zeigen: Angenommen, wir sind unser Geist und dieser Geist ist ein nicht physisches Phänomen. (These 1). Wenn dieser Geist sich nun dazu entscheidet, dass ein Baum gefällt werden soll, und der Baum dann gefällt wird, hat eine nicht physische Entität in der physischen Welt gewirkt (These 2). Dies widerspricht These 3, denn wenn die physische Welt kausal geschlossen ist, kann ein nicht physisches Ding darin nicht kausal wirken.
Dualismus
Descartes würde dem zustimmen, der dritten These widersprechen und das Trilemma als falsch zurückweisen. Descartes Position wird Substanzdualismus genannt. Für ihn gibt es zwei Substanzen, die ausgedehnte physische Welt “res extensa” und die mentale denkende “res cogitans”.2 Die beiden Substanzen sind vollkommen voneinander getrennt, stehen aber in einer Wechselwirkung. Damit der Mensch in der ausgedehnten Welt wirken kann, vermittelt die “Zirbeldrüse”, die im Gehirn sitzt, zwischen ihnen. Ist uns etwas peinlich, vermittelt die Zirbeldrüse dies von unserem Geist an unseren Körper und wir erröten. Tatsächlich ist Descartes Zirbeldrüse aber nicht die Lösung, sie verschiebt das Problem lediglich in ein Organ. Die Frage, wie etwas Mentales in der physischen Zirbeldrüse wirken kann, bleibt bestehen.
Der von G.W. Leibniz (1646–1716) erarbeitete Parallelismus ist eine weitere Form des Dualismus, denn auch er geht von zwei getrennten Entitäten aus. Diese laufen jedoch parallel nebeneinander, ohne zu interagieren. Die Illusion der Kausalität entsteht, da Gott die beiden Substanzen so aufeinander abgestimmt haben soll, dass sie wie ein perfektes Uhrwerk ineinandergreifen.3
Für den Philosophen Nicolas Malebranche (1638–1715) vermittelt Gott zwischen den beiden “Welten”. In jedem Moment, in dem irgendein Mensch auf der Welt etwas Physisches auslöst, wirkt Gott und transferiert dies in die physische Welt. Diese Position wird Okkasionalismus genannt.4
Das Fürwahrhalten von These 1 und These 2, aber nicht These 3, führt also zum Dualismus in seinen verschiedenen Spielarten. Er ist eine Grundannahme des Christentums, in der die Seele nach dem Tod des Körpers in den Himmel oder die Hölle wandert.
Neben dem Interaktionsproblem (Wie können die beiden getrennten Substanzen kausal wirken?) ist eine häufige Kritik des Dualismus, dass das Einführen einer zweiten Substanz ontologisch too much ist (Ockhams Rasiermesser).
Monismus
Der Monismus (vom gr. “monos”: allein, einzig) geht von einer Substanz bzw. Entität aus. Dabei kann es entweder nur das Materielle, also den Körper, oder nur das Geistige geben. Wir fokussieren uns auf das Körperliche, die Position des Idealismus, die besagt, dass alles was existiert geistiger Natur ist verdient ein eigenes Essay. In zusammenarbeit mit den Neurowissenschaften ist die bekannteste und beliebteste monoistische Position des Leib-Seele-Problems der Physikalismus. Er negiert die erste These und sieht den Geist als rein physikalischen Vorgang, wo wir wieder beim Betriebssystem wären welches auf der Hardware läuft. Wie genau auf der Hardware des Körpers der Geist zustande kommt, konnte bisher nicht abschließend geklärt werden, erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass das Ich aus hochgradig vernetzten neuronalen Netzwerken entsteht.5 Kritiker des Physikalismus führen an, dass der Physikalismus First-Person-Experiences (wie in einem Ego-Shooter) nicht erklären kann. Gemeint ist damit die Erfahrung, wie sich Schmerz anfühlt oder wie die Farbe Rot aussieht. Sie werden auch Qualia genannt. Frank Jackson veranschaulicht dies in einem schönen Gedankenexperiment: Mary, die Farbexpertin, weiß alles, was man über Farben wissen kann. Sie kennt die Farblehre, sie kennt RGB und auch CMYK. Doch ihr ganzes Leben verbringt sie in einem Raum, der schwarz-weiß ist und nur schwarze oder weiße Dinge enthält. Sie hat noch nie Rot gesehen, also noch nie die Qualia erfahren, wie es ist, Rot zu sehen. Daraus folgt laut Jackson, dass das Erfahren der Farbe Rot mehr sein muss als ein purer physikalischer Zustand.6 Verteidiger des Physikalismus wie David Lewis und Laurence Nemirow erwidern dieser Kritik, dass Mary zugegebenermaßen zwar eine neue Qualia erfährt, diese aber kein propositionales Wissen (wissen-dass) ist, denn sie weiß ja schon alles, was man über Farben wissen kann, sondern nur eine Erweiterung ihres Erfahrungswissens (wissen-wie-es-ist).
Die in der Einleitung erwähnte Theorie ist der Epiphänomenalismus, eine Art des Physikalismus. Er behauptet, dass das Mentale lediglich ein Nebenprodukt physischer Prozesse ist, ohne eine Rückwirkung auf das Physische zu haben.7 Er Leugnet also These 2. Eine neurowissenschaftliche Erklärung für ihn stammt von Benjamin Libet, der ein Experiment durchführte, in welchem Versuchspersonen eine Handbewegung ausführen sollten und sich genau merken, wann sie die Absicht hatten, dies zu tun. Dabei wurde ihre Gehirnaktivität gemessen und entdeckt, dass das “Bereitschaftspotential” sich bereits 350-500 Millisekunden vor der Absicht, die Handlung auszuführen, aufbaute. Daraus folgt, dass es so scheint, als würde das Gehirn eine Handlung einleiten, bevor unser Ich davon etwas weiß. Es ist aber doch so, dass wir selbst kausal feststellen können, dass, wenn wir in einem Teams-Meeting vergessen, dass wir den Bildschirm teilen und einen Chat offen haben, in dem über andere Meetingteilnehmer gelästert wird, dies eine immense körperliche Reaktion der Peinlichkeit in uns auslöst. Der Epiphänomenalismus erklärt das, indem er sagt, dass beides zwei getrennte Phänomene sind, die nur eine gemeinsame Ursache haben. Unser Gehirn merkt, dass wir den privaten Chat teilen und startet zwei parallele Wirkungen: den physischen des Errötens und den mentalen, welches uns das Gefühl der Peinlichkeit gibt. Die Kette ist also nicht kausal ausgelöst von unserem Ich, sondern parallel ausgelöst von einem Gehirnzustand. Kurz gesagt behauptet der Epiphänomenalismus, dass das Ich lediglich ein Nebenprodukt des physischen ist und wir damit nur unser Gehirn sind. Dies stellt auch den freien Willen infrage, aber darauf kann an dieser Stelle nicht eingegangen werden. Kritiker des Epiphänomenalismus sagen, dass wenn mentale Zustände wirklich kausal wirkungslos wären, sie auch keine Überzeugungen oder Theorien über sich selbst aufstellen könnten.8 Auch evolutionsbiologisch ist fraglich, warum das Bewusstsein nicht aussortiert wurde, denn nur Merkmale, die funktionalen Rollen übernehmen, bleiben durch Selektionsdruck erhalten.
Das Leib-Seele-Problem wird nach wie vor intensiv philosophisch diskutiert. Durch seine Nachvollziehbarkeit ist es ein beliebtes Thema für populär-philosophische Bücher, die auch Laien verstehen und faszinieren können. Die Forschung schreitet rasant voran und verspricht eine spannende Zukunft, die vielleicht ein paar Antworten liefern kann, auch wenn sie sicherlich nur wenige Anhänger des Dualismus überzeugen könnten. Ebenso spannend verspricht die rasante Entwicklung der KI zu werden: sollte eine KI je ein echtes Bewusstsein entwickeln, wäre das nicht der Beweis des Physikalismus?
-
Bieri, Peter (1981). Generelle Einleitung. In: Peter Bieri (Hrsg.), Analytische Philosophie des Geistes, Königstein, Hain. ↩︎
-
Descartes, René (1641). Meditationes de prima philosophia (Meditationen über die Erste Philosophie). ↩︎
-
Bobro, Marc, “Leibniz on Causation", The Stanford Encyclopedia of Philosophy ↩︎
-
Lee, Sukjae, “Occasionalism”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy. ↩︎
-
Metzinger, Thomas (2009). Der Ego-Tunnel: Eine neue Philosophie des Selbst. Berlin Verlag. ↩︎
-
Jackson, Frank (1986). “What Mary Didn’t Know”. The Journal of Philosophy, 83(5), S. 291-295. ↩︎
-
Robb, David and Heil, John, “Epiphenomenalism”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy. ↩︎
-
Robb, David and Heil, John, “Epiphenomenalism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Abschnitt 2.4 Self-stultification. ↩︎